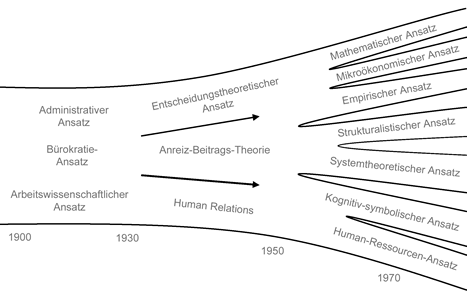Entwicklung der Organisationstheorien
Quellen:
Schreyögg, Georg, Organisation, Grundlagen moderner Organisationsgestaltung, Wiesbaden 1999
Petzold, Hilarion, Integrative Supervision, Meta-Consulting & Organisationsentwicklung, Paderborn 1998
Die klassischen Theorien
Mit seinem Werk „Wirtschaft und Gesellschaft“ hat Max Weber (1864-1920), häufig als „Vater der Organisationstheorie“ bezeichnet, eine wesentliche Grundlage zum Verständnis der Funktionsweise von großen Organisationen in Staat und Wirtschaft geschaffen. Er versuchte die Bürokratie als technisch gesehen rationalste Form der Herrschaftsausübung verständlich zu machen. Diese Organisationsform ist nach Weber allen anderen historisch bekannte überlegen. Sie existiert aufgrund einer aus generellen Regeln geschaffenen Ordnung (Organisationsstruktur) und der Akzeptanz dieser Ordnung durch die Organisationsmitglieder. Dadurch wird die Organisation berechenbar und beherrschbar. Weber sieht sie in erster Linie als Befehls- und Gehorsamssystem. Deshalb ist im Bürokratie-Ansatz der Begriff der „Herrschaft“ ein zentrales Thema. Für Weber ist sie ein Sonderfall der Macht, die auf einem geordneten Gefüge basiert, wodurch sie eine regelmäßige Chance hat, Gehorsam zu finden.
Kennzeichen einer bürokratischen Organisation:
- strikte Regelgebundenheit der Amtsführung;
- Zuständigkeiten und Befugnisse sind generell festgelegt (Amtskompetenzen);
- festgelegtes System von Über- und Unterordnung (Amtshierachie);
- Aktenmäßigkeit aller wesentlichen Vorgänge (Gerüchte, Klatsch, etc. sind ohne Bedeutung);
- die Amtsführung hat strikt neutral nur der Sache zu folgen (Emotionen sind fernzuhalten);
- die sachgerechte Anwendung der Regeln bedarf „Fachleute“ mit einer speziellen Ausbildung je Position;
Weber betrachtete die rasante Entwicklung der bürokratischen Organisationen mit Sorge und für ihn war nicht die Frage, wie man diese noch weiter entwickeln kann, „sondern was wir dieser Maschinerie entgegenzusetzen haben, um einen Rest des Menschentums freizuhalten von dieser Parzellierung der Seele.“
Henri Fayol (1841-1924) betonte noch mehr als Weber den Führungsprozess. Er begründete den administrativen Ansatz und unterscheidet 5 Basiselemente guter Betriebsführung: Planung, Organisation, Befehl, Koordination und Kontrolle.
Fayol betrachtet die Organisation als Maschine und das Organisieren als Ingenieursaufgabe. Er hat allgemeine Organisationsprinzipien definiert:
Arbeitsteilung: Mehr und bessere Arbeit bei gleicher Anstrengung ist durch Spezialisierung erreichbar.
Autorität und Verantwortung: Autorität ist das Recht, Anweisungen zu erteilen, und die Macht , sich Gehorsam zu verschaffen. Autorität verlangt Verantwortung, sie ist das natürliche Gegenstück.
Disziplin: Gehorsam gegenüber allen Konventionen, die in dem Unternehmen gelten.
Einheit der Auftragserteilung: Für jedwede Arbeit sollte ein Beschäftigter Anweisungen nur von einem Vorgesetzten erhalten.
Einheit der Leitung: Alle Anstrengungen, Koordinierungen, Anweisungen müssen auf ein Ziel und eine Direktion hin ausgerichtet sein.
Zentralisierung: Alle Entscheidungen müssen auf einen Ort zusammenlaufen.
Hierarchie: Der Weg, den (fast) alle Kommunikationen zu laufen haben.
Ordnung: Jeder Mitarbeiter und jedes Ding braucht seinen Platz und alles hat auf seinem Platz zu sein.
Der arbeitswissenschaftliche Ansatz kommt aus den Vereinigten Staaten und wurde von Frederick W. Taylor (1856-1915) begründet. Er hat Arbeitsvorgänge wissenschaftlich untersucht und dafür eine geeignete Methodik entwickelt, die systematisch wiederholt und deren Ergebnisse belegt werden konnten. Im Mittelpunkt seines Denkens stand die rationale Arbeitsteilung und die Optimierung der Arbeitsvollzüge. Das führte zur Erfindung des Fließbandes und einer Revolution der industriellen Arbeitswelt. Der „Taylorismus“ wird heute noch (deutlich negativ konnotiert) in diesem Zusammenhang genannt.
Taylors erstes Kernprinzip bestand in der Trennung von Hand- und Kopfarbeit, also die personale Teilung von Arbeitsplanung (Arbeitsvorbereitung) und Ausführung. Umfangreiche Zeit- und Bewegungsstudien führten zum zweiten Kernprinzip der „stückbezogenen Normalleistung“, genauer dem Akkordlohn. Hohe Löhne bei niedrigen Stückkosten sollten die Produktivität der Arbeiter steigern. Das dritte Kernprinzip bezieht sich auf den bestgeeigneten Arbeiter, also einer systematischen Personalauswahl. Das war die Geburtsstunde moderner Personalwirtschaft.
Neoklassische Organisationstheorien
Große Verblüffung lösten zunächst die Hawthorne-Experimente bei den Forschern aus, die von 1924 bis 1932 in Hawthorne durchgeführt wurden. Ziel der Untersuchungen war, Schlüsselfaktoren zur produktivitätsfördernden Gestaltung von Arbeitsbedingungen herauszufinden. Man erhöhte zunächst die Beleuchtungsstärke und stellte zunächst erwartungsgemäß fest, dass auch die Produktivität stieg. Das Staunen kam erst, als man zur Kontrolle die Beleuchtungsstärke wieder senkte, aber die Produktivität weiter stieg. Ja sogar in der Kontrollgruppe, wo die Beleuchtung unverändert blieb, stieg die Produktivität. Während der ganzen Versuchsperiode kam es zu scheinbar paradoxen Produktiviätsveränderungen, die mit herkömmlichen Theorien nicht zu erklären waren. Erst die folgende Untersuchung einer Forschergrupper der Harvard-Universität 1927 machten die Hawthorne-Experimente weltberühmt und zu einem Wendepunkt in der Entwicklung der Organisationstheorie. Es wurden vergleichbare Experimente mit neuen Variablen durchgeführt: Ruhepausen, Arbeitszeit und Entlohnungssystem. „Die Veränderungen wurden mit der Arbeitsgruppe, die sich aus sechs Montage-Arbeiterinnen zusammensetzte, ausführlich besprochen; täglich wurden auch allfällige Probleme diskutiert. Es zeigte sich wieder der selbe Effekt, die Produktivität stieg unaufhörlich an. Als man - irritiert durch den erneuten stetigen Produktivitätsanstieg - die ursprünglichen Arbeitsbedingungen wiederherstellte, stieg trotzdem die Produktivität weiter an.“
Man erkannte, dass die Ursache weniger die äußeren Bedingungen sind, als vielmehr der sozio-emotionale Bereich. Die Beschäftigten waren stolz darauf, Teil einer so wichtigen Gruppe zu sein und haben die Isolation großbetrieblicher Industriearbeit durchbrochen.
Damit wurde der Abschied von der „Unpersönlichkeit der Amtsführung“ eingeläutet und der Human-Relations-Ansatz eingeführt. Faire Tagesleistung, Freundschaftsbeziehungen, Gruppenbeziehungen, Teams usw. rückten in die Mitte der Aufmerksamkeit und verdrängten die eigentliche Arbeitsbedingungen, die nunmehr als gegeben angenommen wurden. Auf diese berechtigte Kritik setzt die Forschung nach dem Human-Ressourcen-Ansatz (s.u.) auf.
In der Anreiz-Beitrags-Theorie nach Chester I. Barnard (1886-1961) ist nicht mehr der Mensch im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, sondern sein Handeln. „Beiträge“ sind die Handlungen, die eine Organisation benötigt, um ihre Ziele zu erreiche. Dafür gibt sie „Anreize“, die ebenso materiell (Lohn) wie immateriell (Stolz, Arbeitsumgebung, etc.) sein können. Barnard grenzt die Organisation nicht mehr deutlich ab. Alle Akteure sind Kooperationsbeteiligte, ober Mitarbeiter, Inhaber, Kapitalgeber, Lieferanten, Kunden ... Da aber Macht und Autorität nicht auf (ausgehandelter) Partnerschaft beruhen, braucht sie eine Art Vertrauensvorschuss, dessen Rahmen Barnard die „Indifferenzzone“ nennt.
In den 50er Jahren hielt die verhaltenswissenschaftliche Perspektive in großem Umfang Einzug in die Organisationstheorie.
Moderne Organisationstheorien
Die Organisationstheorien nach 1950 sind sehr heterogen und treten teilweise in Konkurrenz zueinander.
Zunächst geriet die Logik des Regelgehorsams in Kritik. Traditionelle Strukturen hindern Menschen daran, Initiative und Verantwortungsbewußtsein zu entwickeln, betonen Abhängigkeit und unreflektierten Gehorsam. Sie sind deshalb eine Verschwendung von Human-Ressourcen. Der Human-Ressourcen-Ansatz versuchte Organisationsmodelle zu entwickeln, die den menschlichen Bedürfnissen besser angepasst sind. Sie werden als Ressource gedeutet, die sich wirtschaftlich nutzen lassen müsste. Das hier zugrundeliegende Menschbild stammt aus der Humanistischen Psychologie, wonach der Mensch nach Wachstum und persönlicher Reife strebt. Die idealtypische Organisation erreicht ihre Ziele und die individuellen Ziele der Mitarbeiter. Möglicherweise sind viele Vertreter dieses Ansatzes durchaus humanen Werten verpflichtet, doch der Verdacht drängt sich auf, das der „glückliche“ Fabriksarbeiter eine hohe Produktivität bei geringerem Ausfall (Krankenstand) liefert und generell besser „spurt“ (der Leitlinie folgt), noch dazu innovativ ist und bereit, Defizite von Kollegen durch Mehrleistung auszugleichen. Jedenfalls scheint sich ein ehrlicher Human-Ressourcen-Ansatz bis heute nicht durchgesetzt zu haben. Täglichen Presseberichten zu Folge werden Organisationsoptimierung in der Regel als Belastung der Mitarbeiter durch Personalabbau und Verschärfung der Rahmenbedinungen durchgeführt.
Die „Organisationsentwicklung“, von Schreyögg als Teildisziplin des Human-Ressourcen-Ansatzes gesehen, hat mit beträchtlichen Widerständen zu kämpfen. Die neuen Ideen stoßen besonders bei bürokratischen Organisationen auf Ablehnung. Rensis Likert hat sich einen Namen damit gemacht, das individuelle Verhalten der Mitarbeiter zu ändern in dem er sie durch laufende Befragungen in den Prozess eingebunden hat. Diese starke Psychologisierung der Organisationsentwicklung wird durch die Einbeziehung systemischer Faktoren wieder zurückgedrängt.
Der strukturalistische Ansatz versucht durch komparative Strukturanalysen empirisch möglichst abgesicherte Beschreibungen einer Organisation zu liefern. Ausgangspunkt der Analyse der sogenannten Aston-Gruppe (Pugh/Hickson/Hinings 1968) waren fünf Struktur-Dimensionen:
- Spezialisierung, d.h. Grad der Arbeitsteilung;
- Formalisierung, d.h. Ausmaß der Verschriftlichung von Regeln und Weisungen;
- Standardisierung, d. h. Ausmaß von „Routineverfahren“ (Programme)
- Zentralisierung, d. h. Ausmaß, in dem Entscheidungskompetenzen an der Organisationsspitze angesiedelt sind.
- Konfiguration, d. h. Ausprägung der Strukturgestalt, Zahl der Hierachieebenen, Abteilungsbildung, Verwaltungsanteil, etc.
Ursprünglich war als 6. Dimension die Flexibilität, d.h. die Stabilität oder Veränderlichkeit der Strukturform vorgesehen, was aber ohne längeren Beobachtungszeitraum zu wenig genau erfasst werden konnte.
Die Aston-Gruppe entwickelte ihre bekannt gewordenen sieben Organisationstypen:
- Voll-ausgeprägte Bürokratie (hohes Maß an strukturierter Tätigkeit, zentralistische Entscheidungsstruktur und ein relativ geringes Ausmaß an linienkontrollierten Arbeitsvorgängen)
- Noch nicht voll-ausgeprägte Bürokratie
- Arbeitsprozessbürokratie (hohes Maß an strukturierter Tätigkeit, weitgehende Dezentralisierung und unpersönliche Kontrolle)
- Noch nicht ganz ausgeprägte Arbeitsprozessbürokratie
- Regelarme Arbeitsprozessbürokratie (wie 4., jedoch geringeres Maß an strukturierter Tätigkeit)
- Personale Bürokratie (wenig strukturierte Tätigkeit, zentralisierte Entscheidungsprozesse, stark ausgeprägte Linien-Personen-Kontrolle)
- Implizit strukturierte Organisationen (wie 6., jedoch dezentrale Entscheidungsprozesse)
Genannt werden soll hier noch der kognitiv-symbolische Ansatz als ganz neue Schule der Organisationstheorie, die große Aufmerksamkeit genießt. Anhand dreier Kernthemen lässt sich diese noch etwas ungeschlossene Strömung beschreiben:
Erstens wird die Auffassung vertreten, dass Rationalität eine von vielen Mythen ist, die sich Organisationen schaffen, um Sinn zu stiften. „Das herkömmliche Rationalitätsdenken wird in seiner Funktion für organisatorische Prozesse untersucht, keinesfalls aber als Widerspiegelung der tatsächlichen Logik des Handelns akzeptiert.“
Zweitens wird die Organisationswelt als symbolisch konstruiert gesehen. Das ganze organisatorische Leben ist von Symbolen oder symbolischen Handlungen geprägt. Die „Organisationskultur-Forschung“ ist praktisch ein Kind dieser Ideenschule. Sie geht jedoch noch weiter und betrachtet die ganze Organisation als eine Kulturgemeinschaft (Petrigrew 1979, Ebers 1985).
Drittens herrscht eine grundlegende Skepsis gegenüber dem Objektivitätsbegriff vor. Je nach dem, welches Weltbild vorherrscht, kommt eine entsprechende Beschreibung des Untersuchten heraus. Die theoretische Basis bildet der Konstruktivismus, der eine versprachlichte Verfasstheit von „Wirklichkeit“ betont. Da ein objektives Urteil über die Wahrheit der Konstruktion nicht möglich ist, ist jede Realität Fiktion.
Die Theorie der Postmoderne, die im Gegensatz zur Moderne die Wissensarchive mit dem Argument des Totalitarismus und der Unterdrückung nicht zusammenführt, sondern eine „irreduzible Pluralität“ vertritt, bildet die Plattform dieser Denkrichtung. Die multi-paradigmatische Organisationstherorie, also sich teilweise ausschließende Paradigmen, werden zum erklärten Wissenschaftsprogramm.
Die systemtheoretischen Ansätze haben eine vielfältige Entwicklung genommen. In ihrer ersten Phase haben sie die Organisation als eine Ganzheit gesehen, die aus Teilen besteht, wobei „das Ganze mehr ist, als die Summer seiner Teile“. Diese Aufbaulogik war jedoch für das Organisationsverständnis zu statisch. Mit der Kybernetik ging die Systemtheorie in eine weitere Phase, in dem sie Dynamiken in Form von Regelkreisen beschrieb. (Die Funktionsweise eines Thermostates wurde in diesem Zusammenhang vielfach erläutert.) Da war plötzlich wieder das Maschinenbild, wonach eine Organisation exakt steuerbar sei. Allerdings thematisierte die kybernetische Systemtheorie erstmals das Verhältnis von System und Umwelt als Problem von Konstanz und Veränderung. Später wurden die „offenen Systeme“ diskutiert, die System und Umwelt in Interaktion sahen. Kern weiterer Diskussionen war der eigene Bestand als Grundproblem und Antriebskraft der Organisation. Die Systemtheorie war versucht, eine Analogie zu biologischen Systemen herzustellen und es wurde von Homöostaste als stabilisierenden Faktor gesprochen. Das zeigte sehr bald Schwierigkeiten in der Frage der Grenzziehung zwischen System und Umwelt, denn „soziale Systeme 'sterben' nicht“ und haben deshalb auch keine natürlichen Grenzen.“
Die „Überlebensfrage“ kann nur sehr abstrakt verstanden werden, als historische Systemzustände.
Auch der Integrative Ansatz greift auf teilweise auf systemische Modelle zurück, will sich darauf aber nicht beschränken. Im Sinne einer multitheoretischen und transdisziplinaren Haltung soll der pluralen Wirklichkeit entsprochen werden. „Man muß für die Erklärung sozialer Fragestellungen und Zusammenhänge an sozialwissenschaftlich orientierten Systemansätze Anschluß suchen (...). Doch Damit kommt man nicht aus, denn man kann durch den systemtheoretischen Funktionalismus bei wirklichen Interessenskonflikten wertetheoretischen Auseinandersetzungen nicht entkommen.“
Im Integrativen Ansatz wird hier auf subjekttheoretische und machttheoretische Überlegungen in dialektischen, kulturhermeneutischen und strukturalistischen Modellen als Referenzrahmen zurückgegriffen.
An dieser Stelle zeigt sich der Integrative Ansatz ambivalent. Einerseits ist es generell seine Stärke auf verschiedenste Referenzmodelle zurückzugreifen und stellt damit eine große Weitung dar. Andererseits bleibt dieser Ansatz mangels eigenständigem Modell der Organisationstheorie unfassbar und schwer handhabbar. Wenn die Integration geeigneter Referenzmodelle bzw. eine Modellpluralität selbst zum Modell erklärt wird, besteht die Gefahr, als eklektisch kritisiert zu werden, auch wenn „vernetztes Denken“ zweifellos ergiebiger als die Summe der einzelnen Aspekte ist. „So gibt es eben unterschiedliche 'Managementideologien' als Idealmodell darüber, wie ein optimale Management auszusehen habe, und das ist gut so, den der Vergleich und die Analyse solcher Modelle (...) führt zu komplexeren Sichtweisen und dazu, daß die aufgefundenen Unterschiedlichkeiten und die zugänglich gewordene Kontingenz (...) die Möglichkeit von Korrektiven und Innovationen eröffnet.“
Die organisationstheoretische Zugangsweise im Integrativen Ansatz erklärt weniger eine „ideale Organisation“ bzw. ein „ideales Management“, sondern bietet vielmehr ein differenziertes Verstehen einer Organisation. Nach Petzold wird diese von folgenden Strukturelementen bestimmt
- Die Unternehmensphilosophie (Leitwerte, Ziele, normative Regeln, etc.)
- Die Corporate Identity (im kolletiven Prozess entwickeltes Leitbild, Führungsgrundsätze, Konzepte zur Organisationskultur, etc. vor allem zur Konstitution von Identität)
- Das Unternehmenskonzept (Definition auf welche Art und Weise die Zielsetzungen des Unternehmens erreicht werden soll.)
- Die Unternehmensperformanz (Die Umsetzung der Vorgaben, die operative Leistungsfähigkeit des Unternehmens, ...)
- Die Unternehmenskultur („klimatische“ und „atmosphärische“ Phänomene und ihre Manifestation in der Organisation)